Das Immunsystem ist den meisten Menschen ein Begriff. Doch was hat es mit dem Komplementsystem auf sich? Dahinter verbirgt sich ein wichtiger Teil der Immunabwehr, der wesentlich dazu beiträgt, Fremdzellen und andere Eindringlinge wie Bakterien, Viren oder Pilze im Blutkreislauf zu bekämpfen. Die Grundlage des Komplementsystems bilden 30 Proteine, die sogenannten Komplementproteine (auch Komplementfaktoren genannt).1 Mediziner*innen können die Konzentration dieser Proteine im Blut messen – etwa wenn sie vermuten, dass das Komplementsystem übermäßig aktiv ist.2 Das ist zum Teil bei bestimmten seltenen Nierenerkrankungen der Fall.
Das Komplementsystem unter der Lupe
Die Proteine des Komplementsystems zirkulieren normalerweise in weitestgehend inaktiver Form frei im Blut oder sind auf der Oberfläche bestimmter Zellen verankert.1 Zu diesen Proteinen gehören beispielsweise C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 und C9. Diese und weitere Komplementfaktoren werden aktiviert, sobald ein Krankheitserreger (zum Beispiel ein Virus oder Pilz) im Körper erkannt wird. Die Proteine lösen dann eine Kettenreaktion aus, bei der die Aktivierung eines Proteins die Aktivierung des nächsten Proteins zur Folge hat. Das Komplementsystem kann auf drei verschiedenen Wegen aktiviert werden. Dazu zählen der klassische Signalweg, der Lektin-Signalweg und der alternative Signalweg.3 Die Wege unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie in Gang gesetzt werden, münden aber in einen letzten gemeinsamen Mechanismus. Das Ziel: die Bekämpfung des Krankheitserregers.
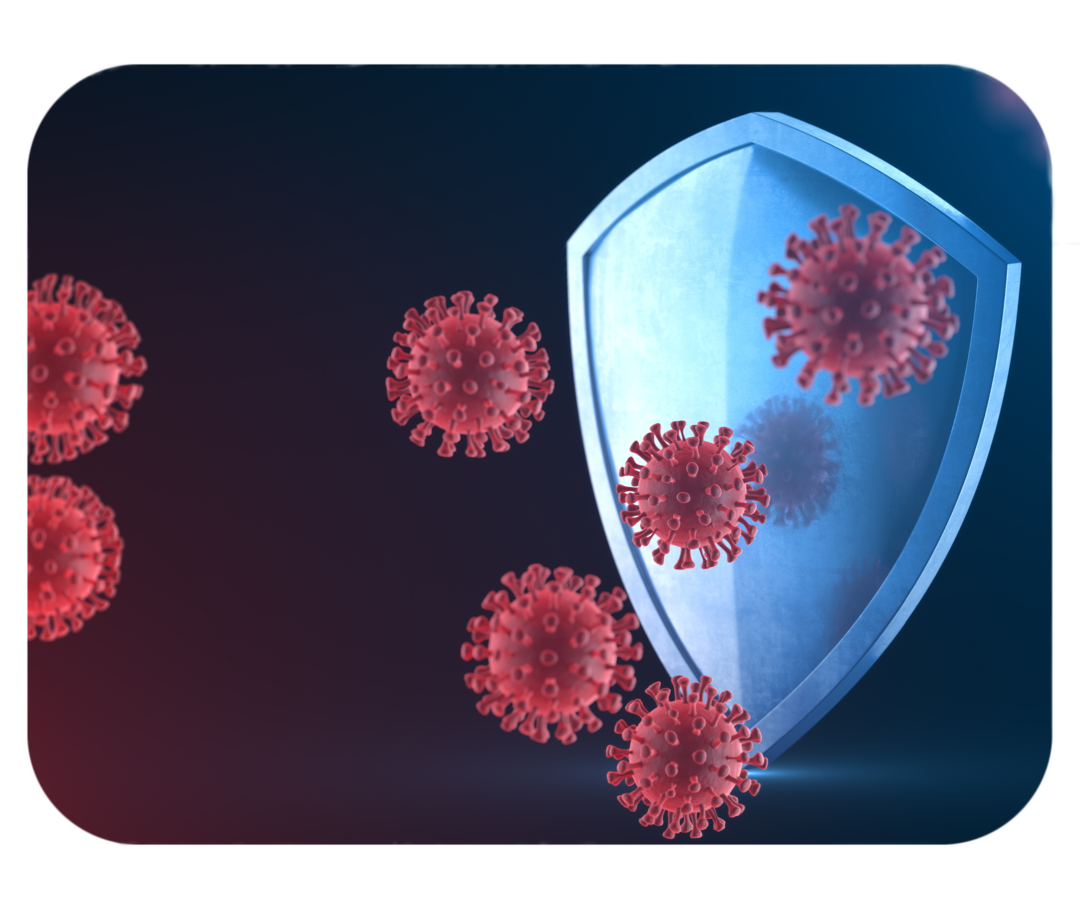
iStock-1219791010_creativeneko
Wie ordnen sich komplementvermittelte Nierenkrankheiten in das breite Spektrum chronischer Nierenerkrankungen ein?
Experte Prof. Dr. Jörg Latus erklärt kurz und verständlich, wie das sogenannte Komplementsystem seltene Nierenerkrankungen auslösen kann.
Experten-Finder
Sie suchen Expert*innen zur Behandlung Ihrer seltenen Nierenerkrankung? Unser Experten-Finder kann Ihnen helfen, Spezialzentren zu finden, die Betroffene von seltenen Nierenerkrankungen betreuen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl und Ihren Wohnort im Suchfeld ein.

iStock-1140828812_Rawf8
Bei gesunden Menschen wird das Komplementsystem nach der Abwehrreaktion wieder weitestgehend inaktiviert. Nur der alternative Komplementweg behält stets eine niedrige, grundlegende Aktivität bei.4 Bei bestimmten Krankheiten wie Autoimmunerkrankungen (Fehlsteuerung des Immunsystems) geraten die komplexen Abläufe des Immunsystems jedoch durcheinander, was zu fehlerhaften Reaktionen im Körper führt.5 Ein Ungleichgewicht im Komplementsystem, entweder durch unzureichende oder übermäßige Komplementaktivität, kann erhebliche gesundheitliche Folgen haben.6,7,8,9,10
Das Komplementsystem vereinfacht erklärt
Ein Komplementärsystem lässt sich am ehesten mit einer Armee vergleichen, die versucht, ein Gebiet vor einem Feind zu schützen und zu verteidigen. Sobald ein Feind in dem Gebiet gesichtet wird, nimmt die Armee ihre Arbeit auf und tut alles Nötige, um den Feind zu eliminieren. Eine ähnliche Rolle hat das Komplementsystem als Teil des Immunsystems. Eine Reihe von Proteinen bildet die Armee. Sie ist zunächst weitestgehend inaktiv und wird erst aktiviert, wenn ein Krankheitserreger in den Körper eingedrungen ist. Ist das der Fall, löst das eine Kettenreaktion aus, die dazu führt, dass der Eindringling (Erreger) bekämpft wird. Ist dies gelungen, stellen die Komplementproteine ihre Arbeit vorerst weitestgehend wieder ein.

Komplementfaktoren und ihre Rolle bei Nierenerkrankungen
Bei einigen seltenen Nierenerkrankungen, den sogenannten komplementvermittelten Nierenerkrankungen, ist das Komplementsystem übermäßig aktiv.11,12 Zu diesen Erkrankungen zählen die C3-Glomerulopathie (C3G)und die IgA-Nephropathie (IgAN).13,14,15,16 Mediziner*innen können die Komplementaktivierung durch eine Untersuchung der Komplementkonzentration im Plasma (zellfreie Blutflüssigkeit) nachweisen.17Meist messen sie die Konzentration der Komplementproteine C3 und C4.18 In bestimmten Laboren kann das Blut auf weitere Komplementfaktoren und ihre Untergruppen untersucht werden. Die Untersuchung dieser Proteine dient neben der Diagnose auch der Überwachung von Nierenkrankheiten.18
Als Normwerte der Komplementproteine C3 und C4 gelten:19,20
- C3: 0,9 bis 1,8 Gramm pro Liter (g/l)
- C4: 0,1 bis 0,4 g/l
Beispiel C3-Glomerulopathie
Patient*innen mit einer C3-Glomerulopathie haben meist niedrigere Konzentrationen des Komplementproteins C3 im Blut als gesunde Menschen.21,22 Im Nierengewebe der Betroffenen finden sich Ablagerungen von C3, es kommt zu Entzündungen und Vernarbungen.21,22 Wichtig: Nicht bei allen Patient*innen mit einer C3-Glomerulopathie sind die Spiegel des Komplementproteins C3 erniedrigt.23 Zudem können niedrige Werte auch auf andere Nierenerkrankungen hinweisen.24 Zusätzlich zur Untersuchung des Komplementproteins ist daher eine Nierenbiopsie nötig, um die C3G sicher zu diagnostizieren.21,24 Komplementfaktoren wie C3 können auch aufgrund von anderen Reaktionen und Erkrankungen im Körper erniedrigt sein, die nicht mit den Nieren in Verbindung stehen – etwa Eiweißmangel und Lebererkrankungen.20 Informationen zu den Komplementproteinen sind daher nur ein Puzzleteil bei der Diagnose von Nierenerkrankungen.
Therapieansatz Komplementsystem
Die Entwicklung von sogenannten Komplementinhibitoren (Hemmer des Komplementsystems) gilt als einer der größten Durchbrüche in der Nierenheilkunde.25 Medikamente, die das Komplementsystem hemmen, haben zum Beispiel die Behandlung einer der schwersten Nierenerkrankungen, des atypischen hämolytisch-urämischen Syndroms (aHUS), deutlich verbessert.25 Auch bei dieser Erkrankung ist das Komplementsystem überaktiv.26 Eine Herausforderung bei der Entwicklung von Komplementinhibitoren: Sie müssen zielgerichtet auf den richtigen Teil des überaktivierten Komplementsystems wirken, dürfen aber gleichzeitig nicht die Abwehrfunktion des Systems gegenüber Krankheitserregern schwächen.27
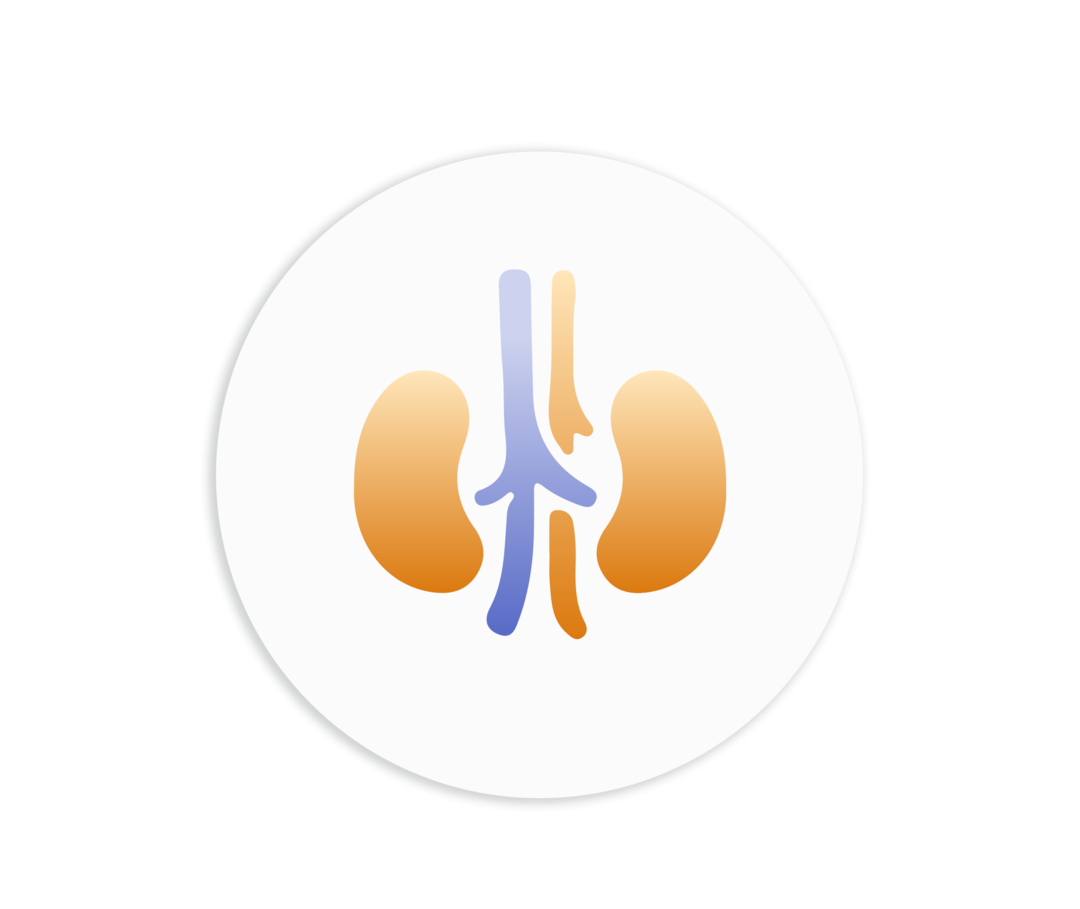
Das könnte Sie auch interessieren:

iStock-1140828812_Rawf8
Experten-
Finder
Sie suchen Expert*innen für seltene Nierenerkrankungen in Ihrer Region? Unser Experten-Finder hilft Ihnen weiter.

iStock-1205340770_solarseven
Weitere Blutwerte zur Niere
Erfahren Sie mehr über weitere Blutwerte, die bei der Diagnose von Nierenkrankheiten von Interesse sind.

iStock-1370436715_Ivan-balvan
Urinwerte zur Niere im Blick
Mediziner*innen können verschiedene Urinwerte ermitteln, um mehr über den Zustand der Nieren zu erfahren.
Quellen
- Sarma JV, Ward PA. The complement system. Cell Tissue Res. 2011 Jan;343(1):227-35. doi: 10.1007/s00441-010-1034-0, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Willrich MAV, Braun KMP, Moyer AM, et al. Complement testing in the clinical laboratory. Crit Rev Clin Lab Sci. 2021 Nov;58(7):447-478. doi: 10.1080/10408363.2021.1907297, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- viamedici.thieme.de. Komplementsystem. https://viamedici.thieme.de/lernmodul/549612/539527/komplementsystem, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Ahmad SB, Bomback AS. C3 Glomerulopathy: Pathogenesis and Treatment. Adv Chronic Kidney Dis. 2020 Mar;27(2):104-110. doi: 10.1053/j.ackd.2019.12.003, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Mollnes TE, Jokiranta TS, Truedsson L, et al. Complement analysis in the 21st century. Mol Immunol. 2007 Sep;44(16):3838-49. doi: 10.1016/j.molimm.2007.06.150, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Botto M, Kirschfink M, Macor P, et al. Complement in human diseases: lessons from complement deficiencies. Mol Immunol. 2009 Sep;46(14):2774-83. doi: 10.1016/j.molimm.2009.04.029, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Grumach AS, Kirschfink M. Are complement deficiencies really rare? Overview on prevalence, clinical importance and modern diagnostic approach. Mol Immunol. 2014 Oct;61(2):110-7. doi: 10.1016/j.molimm.2014.06.030, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Mayilyan KR. Complement genetics, deficiencies, and disease associations. Protein Cell. 2012 Jul;3(7):487-96. doi: 10.1007/s13238-012-2924-6, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Ricklin D, Lambris JD. Complement in immune and inflammatory disorders: pathophysiological mechanisms. J Immunol. 2013 Apr 15;190(8):3831-8. doi: 10.4049/jimmunol.1203487, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Skattum L, van Deuren M, van der Poll T, et al. Complement deficiency states and associated infections. Mol Immunol. 2011 Aug;48(14):1643-55. doi: 10.1016/j.molimm.2011.05.001, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Thurman JM. Complement and the Kidney: An Overview. Adv Chronic Kidney Dis. 2020 Mar;27(2):86-94. doi: 10.1053/j.ackd.2019.10.003, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Luo W, Olaru F, Miner JH, et al. Alternative Pathway Is Essential for Glomerular Complement Activation and Proteinuria in a Mouse Model of Membranous Nephropathy. Front Immunol. 2018 Jun 22:9:1433. doi: 10.3389/fimmu.2018.01433, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Smith RJH, Appel GB, Blom AM, et al. C3 glomerulopathy - understanding a rare complement-driven renal disease. Nat Rev Nephrol. 2019 Mar;15(3):129-143. doi: 10.1038/s41581-018-0107-2, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Schena FP, Esposito P, Rossini M, et al. A Narrative Review on C3 Glomerulopathy: A Rare Renal Disease. Int J Mol Sci. 2020 Jan 14;21(2):525. doi: 10.3390/ijms21020525, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Wong EKS, Kavanagh D. Diseases of complement dysregulation-an overview. Semin Immunopathol. 2018 Jan;40(1):49-64. doi: 10.1007/s00281-017-0663-8, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Boyd JK, Cheung CK, Molyneux K, et al. An update on the pathogenesis and treatment of IgA nephropathy. Kidney Int. 2012 May;81(9):833-43. doi: 10.1038/ki.2011.501, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Poppelaars F, Thurman JM. Complement-mediated kidney diseases. Mol Immunol. 2020 Dec: 128:175-187. doi: 10.1016/j.molimm.2020.10.015, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Thurman JM. Complement in Kidney Disease: Core Curriculum 2015. Am J Kidney Dis. 2015 Jan; 65(1): 156-168. doi: 10.1053/j.ajkd.2014.06.035, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- gesundheit.gv.at. C4 Komplement (C4K). https://www.gesundheit.gv.at/labor/laborwerte/immunsystem/c4-komplement.html, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- gesundheit.gv.at. C3c Komplement (C3CK). https://www.gesundheit.gv.at/labor/laborwerte/immunsystem/c3c-komplement.html, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Heiderscheit AK, Hauer JJ, Smith RJH. C3 glomerulopathy: Understanding an ultra-rare complement-mediated renal disease. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2022 Sep;190(3):344-357. doi: 10.1002/ajmg.c.31986, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Martin B, Smith RJH. C3 Glomerulopathy. In: GeneReviews® [Internet]. 2007. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1425/, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Tarragon Estebanez B, Bomback AS. C3 Glomerulopathy: Novel Treatment Paradigms. Kidney Int Rep. 2023 Dec 16;9(3):569-579. doi: 10.1016/j.ekir.2023.12.007, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Willows J, Brown M, Sheerin NS. The role of complement in kidney disease. Clin Med (Lond). 2020 Mar;20(2):156-160. doi: 10.7861/clinmed.2019-0452, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Fakhouri F, Schwotzer N, Golshayan D, et al. The Rational Use of Complement Inhibitors in Kidney Diseases. Kidney Int Rep. 2022 Mar 4;7(6):1165-1178. doi: 10.1016/j.ekir.2022.02.021, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Michels MAHM, van d Kar NCAJ, Okrój M, et al. Overactivity of Alternative Pathway Convertases in Patients With Complement-Mediated Renal Diseases. Front Immunol. 2018; 9: 612. doi: 10.3389/fimmu.2018.00612, letzter Aufruf am 17.07.2024.
- Harris CL. Expanding horizons in complement drug discovery: challenges and emerging strategies. Semin Immunopathol. 2018; 40(1): 125-140. doi: 10.1007/s00281-017-0655-8, letzter Aufruf am 17.07.2024.